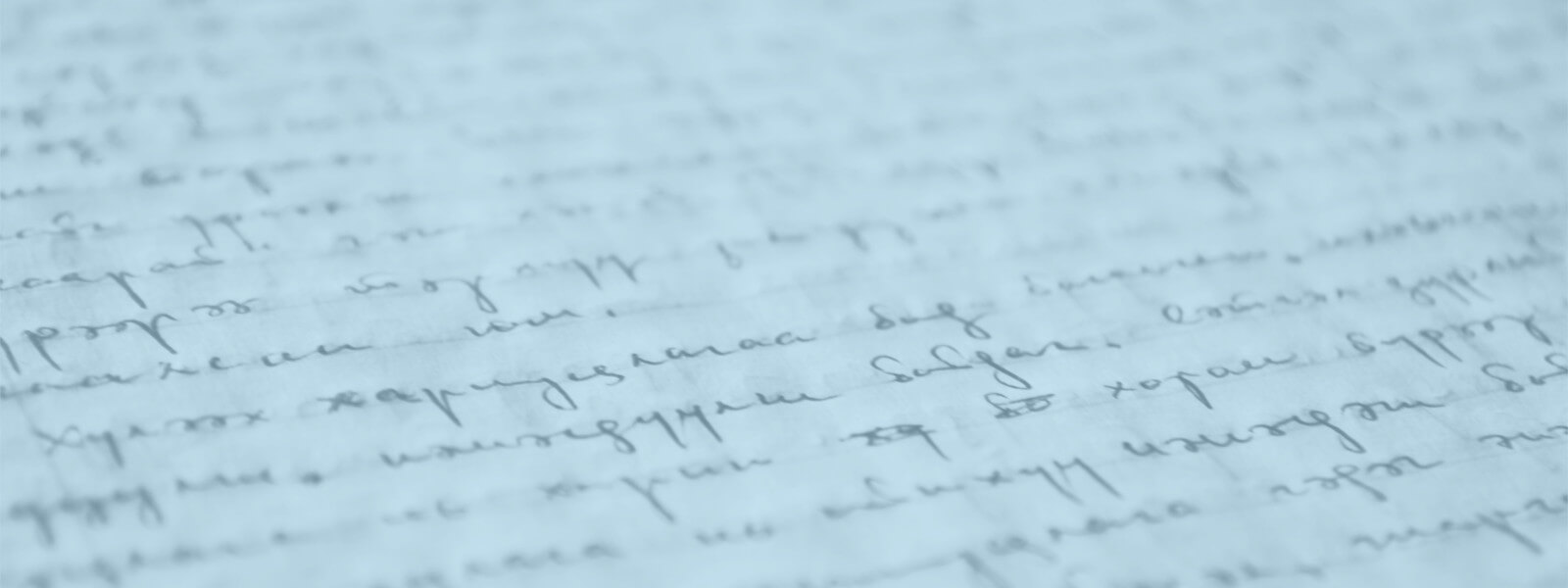Eine der wichtigsten Entscheidungen bei der Gründung eines Unternehmens ist die Wahl der Rechtsform. Diese gehen auf die verschiedenen Ausgangsbedingungen ein und eignen sich mal mehr mal weniger für das Gründungsvorhaben.
Entscheidungsfaktoren bei der Wahl der Rechtsform
Die folgenden Fragen sollten vor der Wahl einer Rechtsform beantwortet werden:
- Anzahl der Gründer: Von wie vielen Personen wird das Unternehmen gegründet und wer wird das Unternehmen in Zukunft leiten?
- Kapital: Wie viel Eigenkapital ist man bereit aufzubringen? Soll in Zukunft Fremdkapital beispielsweise von Investoren und Gesellschaftern eingebunden werden?
- Risikobereitschaft: Ist das Vorhaben an sich risikobehaftet? Ist man bereit mit dem privaten Vermögen zu haften?
- Buchhaltung: Soll die Bürokratie auf ein Minimum beschränkt werden oder ist man bereit für eine aufwendigere Buchhaltung und Formalitäten?
- Zeit: Wie eilig hat man es mit der Gründung?
- Gewinnabsicht: Hat das Vorhaben einen zentralen gemeinnützigen Aspekt?
Weiterhin sind das Tätigkeitsfeld, die Unternehmensziele sowie die Bereitschaft die Unternehmenszahlen offen zu legen weitere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Doch die Entscheidung ist nicht in Stein gemeißelt – Unternehmen wandeln sich und so ist es auch im Nachhinein möglich, die Rechtsform zu wechseln.
Kategorisierung
Die einzelnen Rechtsformen können grob in drei Kategorien unterteilt werden:
- Einzelunternehmer
- Üblicherweise Freiberufler, Einzelkaufleute und Kleingebwerbetreibende
- Personengesellschaften
- Hierunter fallen die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), die Offene Handelsgesellschaft (OHG) sowie die Kommanditgesellschaft (KG)
- Kapitalgesellschaften
- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), die Aktiengesellschaft (AG) und die eingetragene Genossenschaft (eG) fallen unter Kapitalgesellschaften
Laut einer Erhebung des statistischen Bundesamtes ergab sich die Verteilung der rechtlichen Einheiten nach zusammengefassten Rechtsformen im Berichtsjahr 2022 wie folgt: Insgesamt wurden 3.435.478 Unternehmen registriert – davon waren gut über die Hälfte Einzelunternehmer (2.033.401), den zweiten Platz belegten Kapitalgesellschaften mit 813.175 und Personengesellschaften mit 414.176 Unternehmen. Den Rest machten sonstige Rechtsformen beziehungsweise Mischformen aus.
Die verbreitetsten Rechtsformen im Überblick
Einzelunternehmen
Die beliebteste Rechtsform in Deutschland ist das Einzelunternehmen. Die Formalitäten und der bürokratische Aufwand beschränken sich auf ein Minimum und es ist kein Startkapital von Nöten. Einzelunternehmer haften jedoch mit ihrem Privatvermögen.
GbR und OHG
Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts und die offene Handelsgesellschaft sind sich sehr ähnlich. Der Unterschied liegt in den Unternehmenszielen: während bei einer GbR das Unternehmensziel auch gemeinnützig sein kann, steht bei einer OHG das Gewinninteresse an erster Stelle. Die Gründung ist bei beiden Rechtsformen recht einfach und auch ohne notarielle Beglaubigung des Gesellschaftsvertrags gültig. Jedoch haften die Gesellschafter unbeschränkt mit ihrem Privatvermögen.
KG
Die Bürokratie bei der Gründung einer Kommanditgesellschaft fällt ähnlich schlank aus, wie bei GbR und OHG. Bei der KG sind Rollen der Gesellschafter jedoch klar verteilt: der Kommanditist, oft ein Investor, kann zwar auch aktiv am Unternehmensgeschehen beteiligt sein, haftet jedoch nicht mit seinem Privatvermögen, sollte etwas schief gehen. Der Komplementär haftet mit seinem kompletten Vermögen.
Gmbh
Der Vorteil einer GmbH steckt ihr schon im Namen: die Haftung ist beschränkt, dafür jedoch der Aufwand in Sachen Buchhaltung groß. Haften tun die Unternehmer in diesem Fall nicht mit ihrem Privatvermögen sondern mit dem entsprechenden Anteil am Unternehmensvermögen. Eine GmbH zu gründen ist jedoch kostspielig: es Bedarf mindestens 25.000 € Startkapital.
Eine Sonderform ist die gGmbH (gemeinnützige GmbH) – für Unternehmungen mit gemeinnützigem Hintergrund und gleichzeitigem Fokus auf Gewinnerzielung.
AG
Die Aktiengesellschaft ist neben der GmbH eine weitere beliebte Rechtsform in Deutschland, vor allem bei großen Unternehmen wie BMW. Hier verhält es sich mit der Haftung, wie bei allen Kapitalgesellschaften: Das Privatvermögen ist geschützt und die Haftung auf das Unternehmenskapital beschränkt.
Quellen
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Unternehmen/Unternehmensregister/Tabellen/unternehmen-rechtsformen-wz08.html
https://www.ihk.de/rhein-neckar/recht/wirtschaftsrecht/gesellschaftsrecht/unternehmensformen-rechtsformen-938792
https://gruenderplattform.de/rechtsformen#beliebtheit
https://qonto.com/de/blog/rechtsformen/tipps/rechtsformen-unternehmen
Bildquelle
Foto von Karolina Grabowska von Pexels: https://www.pexels.com/de-de/foto/person-schreibtisch-arbeiten-rechtsanwaltskanzlei-7876093/